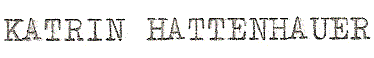
Goslarsche Zeitung, 1. November 2002
»Lichtreise zum Geburtstag«
Projekt »Offene Kirche« feiert in der Marktkirche
GOSLAR. Seinen 10. Geburtstag feiert das Projekt »Offene Kirche«. Diese zehn Jahre Kirchenpädago-gik werden am morgigen Samstag, 2. November, um 18 Uhr in der Marktkirche gewürdigt.
Dorothee Prüssner, Kirchenpädagogin im Kirchen- verband, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Kirchenpädagogen, Christiane Kürschner, sowie Oberbürgermeister Dr. Otmar Hesse sprechen Grußworte.
»Lichtarchitekt« Pfarrer Andreas Lohrey wird in Lichtlinien, Lichtspuren und Bildern den Kirchen- raum neu erstehen lassen.
Gothaer Allgemeine, 16. Dezember 2003
Heilende Kunst
Kommentar von Felix Mannheim
Beethoven wirkt gegen Kopfschmerzen. Bestimmt — zumindest, wenn noch ein bisschen Ruhe dazu- kommt. Aber was empfiehlt der Arzt? Aspirin.
Kunst ist eben keine klassische Medizin. Das macht es schwer, in Krankenhäusern Geld für sie locker zu machen.
Umso bemerkenswerter ist der Schritt im Helios- Krankenhaus. Rund 4000 Euro ließ sich die Ge- schäftsführung die Gestaltung der Decken in zwei Zimmern der Intensivstation kosten — und geht damit einen völlig neuen Weg. Als Vorreiter galt bisher die Universitätsklinik in Jena, wo vor gut
Und Krankenzimmer bleibt weiter tristes Kranken- zimmer. Auf Intensivstationen liegen Menschen nach Operationen oder schweren Unfällen. Oft können sie sich nicht bewegen, sind gezwungen, den ganzen Tag an die Decke zu starren. Kann sich Kunst irgendwo mehr lohnen, als hier?
Es ist zu hoffen, dass der Versuch Nachahmer findet. Denn wer wollte ausschließen, dass bunte Linien als Anregung für Sinne und Fantasie helfen, nach einer Operation ins Leben zurück zu finden?
Lichtblicke auf Intensivstation
Gothaer Künstlerin gestaltete Decken
Gotha. (tlz/bau) Auf ein einzigartiges Unterfangen hat sich die Gothaer Helios-Klinik eingelassen: In zwei Patientenzimmern der Intensivstation gestal- tete die Künstlerin Katrin Hattenhauer (Gotha/- Berlin) die Decken neu. Sie spricht von »Lichtbli- cken« für die Patienten. Das sind abstrakte Formen auf einer orangefarbenen Decke und beinahe figür- liche Darstellungen auf einem herbstlich grünen Untergrund.
»Ich möchte nie auf einer Intensivstation liegen, wenn es aber sein muss, dann hier«, lobt Uwe Klingel von der Helios-Geschäftsleitung das Projekt, für das sich die Mitarbeiter eingesetzt hatten, allen voran Stationsschwester Heike Bluhm als Ideen- geberin.
Ein Erlebnis, das die 35jährige Künstlerin aus eigener Erfahrung kennt. »Ich habe die Decke angestarrt und mich gelangweilt«, erinnert sie sich an eigene, langwierige Krankenhauserfahrungen. Klaus Roewer hob in seiner Laudatio hervor, dass die Belegschaft diese künstlerische Gestaltung aktiv gewünscht und gefördert habe und die Kranken- haus-Leitung diesem außergewöhnlichen Vorhaben den Weg geebnet hat.
Momentaufnahmen der Liebe
Das Liebespaar-Projekt von Katrin Hattenhauer bringt alte und neue Paare zusammen
Von Daniela Tratschitt
Die Liebe zwischen Mann und Frau ist so alt wie die Menschheit. Und schon immer haben Künstler ver- sucht, dieses aufregende Gefühl in Wort und Bild zu fassen. Von Adam und Eva bis zu Brad Pitt und Angelina Jolie - wer verliebt ist, ist auch interessant für die anderen. Wie sieht die Liebe aus? Was ist das Besondere an ihr? Was macht Liebende so anziehend für ihre Umwelt? Und kann ein Maler oder Dichter diesen Zustand angemessen einfangen?
Eines der berühmtesten deutschen Gemälde eines Liebespaares hängt im Gothaer Schlossmuseum. Gemalt um 1480 / 85 von einem unbekannten Künstler der Vor-Dürer-Zeit zeigt esGraf Philipp den Jüngeren von Hanau-Münzenberg (1449 - 1500) und seine unstandesgemäße Partnerin Margarethe Weißkirchner. Der Graf lebte nach dem Tod seiner Ehefrau Adriane von Nassau (gestorben 1477) mit der Bürgerlichen zusammen.
Auf dem Bild sieht man die beiden einander liebe- voll zugeneigt. Sie berühren sich, sehen verträumt, ganz in ihrer Zweisamkeit aufgelöst aus. Scheu blickt Margarethe nach unten auf eine kleine Rose, fast so, als hätte sie diese gerade von ihrem Lieb- haber geschenkt bekommen. Die andere Hand um- fasst einen Teil seiner Kleidung. Diese Geste scheint ausdrücken: Er gehört zu mir. Philipp dagegen um- fasst ihre Taille, zieht sie an sich, lässt seinen Blick über Margarethe schweifen. Er wirkt, als wäre er

Über den Ungleichen hängen zwei Spruchbänder. Rechts über ihr steht: »Sye hat uch nyt veracht Dye uch daz Schnürlin hat gemacht«. Links über dem Mann steht als Erwiderung: »Un byllich het Sye esz gedan Want Ich han esz sye genissen lan«. Sie hat ihm ein kunstvoll geformtes Schnürlein gefertigt, welches er stolz trägt und sie umfasst hält. Dieses Schnürlein war ein Merkzeichen, das an der Klei- dung befestigt wurde und auf das Alte Testament (Moses 4, 15, 38) zurückgeht. Ein Merk- zeichen hat sie ihm gemacht, so als wolle sie sagen: Vergiss mich nicht.
Das Motiv ist für die damalige Zeit außergewöhn- lich. Zwei Menschen aus verschiedenen Ständen, Mann und Frau, in Liebe vereint. Das Werk ist das erste bedeutende Doppelbildnis in der deutschen Tafelmalerei, viele interpretieren es als Gatten- oder Verlöbnisbild. Es gehört zu den herausragen- den Schöpfungen der spätmittelalterlichen Malerei
tugendhaften und blühenden Lebens, der Liebe.
Vor dem Hintergrund dieser wahren Liebesgeschich- te stellt das »Gothaer Liebespaar«, im Spannungs-feld zwischen gesellschaftlichen Standesgrenzen und den Idealen von Minne und Liebe, ein einzig-artiges Dokument einer herzlichen, aber unrecht-mäßigen Verbindung zwischen einem Adligen und einer Bürgerlichen dar.
Das Werk wurde 1844 in Gotha das erste Mal kata- logisiert. Dann verschwand es für lange Zeit im Depot des Thüringer Museums. Erst am 1. Juni 1997 fand es nach umfassender Restaurierung wieder seinen Platz im Museum. Seither hat es viele Freun- de. Denn immer wieder gestehen sich .vor dem Bild Liebende ihre Zuneigung, viele schließen davor so- gar den Bund fürs Leben. Es ist zu einer beliebten Kulisse bei Hochzeiten geworden.
Einen großen Anteil am neuen Ruhm des Gemäldes hat Katrin Hattenhauer. Sie gab ihrem Mann - da- mals in leitender Funktion im Museum - den Anstoß zur erneuten Ausstellung des Werkes. »Mich hat diese Abbildung zweier Liebender schon immer fasziniert. Sie hat Kraft und strahlt soviel Wärme aus. Als man nach einem neuen Blickfang suchte, war es für mich klar, dass dieses Bild der Höhe- punkt in der Sammlung des Museums ist«. Doch selbst nachdem das Bild aus der Versenkung her- vorgeholt wurde, ließ das Gemälde Katrin Hatten- hauer nicht los. »Ich wollte schon lange etwas ma- chen, das mit dem Gothaer Liebespaar in Verbin- dung steht.«. Als sie dann bei einem Kulturtreff in der thüringischen Stadt den Vorsitzenden des Essenheimer Kunstvereins, Andreas Preywisch, kennen lernte, schien die richtige Stunde gekom- men. Die erste Zusammenarbeit kam anlässlich des Einweihungsfestes des Kunstforums Rheinhes- sen 2003 zustande, als die in Berlin lebende Künst- lerin ein Model aus Gotha bemalte.
2006 kommt dann endlich die Liebe zum Zug. Nach dem Vorbild des historischen Liebespaares will Hat- tenhauer moderne Paare fotografieren und an- schließend die Vorlagen umgestalten. Der Kunstver- ein sucht per Mundpropagandaund über die Presse nach interessierten Paaren. Von Frisch verliebten bis zu alten Ehepaaren, von Kindern bis Erwachse-
BURGERSTIFTUNG: Künstlerin Katrin Hattenhauer arbeitete mit Grundschule In der Feige zusammen
Welche Stadt hat das schon? Einen Stadtführer von Kindern für Kinder. Die Hertener Bürgerstiftung machte es möglich. Kinder stellen „ihre Stadt" vor und empfehlen die schönsten Ecken.
Wo gibt es das leckerste Eis, wo die schönsten Wiesen zum Spielen? Das alles haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule In der Feige heraus- gefunden. Bei diesem freiwilligen Projekt, das von der Bürgerstiftung im Rahmen ihres Projektes »Kinder erkunden ihre Stadt« angestoßen wurde, haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c und 2c unter der Anleitung von Lehrerin Dina Daniels mitgemacht. Die Kinder haben ihre Lieblingsplätze fotografiert, gemalt und dazu Geschichten erfun- den, oder sogar eine ganz neue Person erfunden: »Yzoh«, ein Außerirdischer, der auf der Erde und dabei ausgerechnet in Herten landet. Die Kinder erklären Yzoh, wo er sich befindet und stellen ihm Herten vor. Der Schüler Torben Seeger ist der Erfinder dieser Figur.
An die praktische Umsetzung der Idee zu einem Kinderbuch machte sich seit einer Woche nun die

»Ich habe es mir verdient«
Nach DDR und Stasi-Haft:
Malerin Katrin Hattenhauer stellt fröhliche Bilder aus
Mitte (indy). Es sind farbenfrohe Bilder, von sich wiegenden Körpern und tanzenden Harlekins, voller Energie und Leben: Pure Fröhlichkeit ist es, die aus den Werken der Berliner Künstlerin Katrin Hattenhauer spricht. Eine Fröhlichkeit, die sie lange Zeit nicht empfinden konnte: Kurz vor der Wende kam die DDR-Bürgerin in Stasi-Haft. Mit den Bildern der Ausstellung »Freiheit wagen« will sie die Schat- ten der Vergangenheit nun hinter sich lassen.
Rückblick: Im Wendejahr 1989 engagiert sich Katrin Hattenhauer, damals Studentin am Theologischen Seminar Leipzig, im »Arbeitskreis Gerechtigkeit«. Mit mehreren politischen Aktionen will die zehnköp- fige Gruppe die Bürger der DDR mobilisieren, sie für die Ungerechtigkeiten im Staat sensibilisieren.
»Alles, was Spaß gemacht hat, var vom Staat ver- boten. Ich hätte dort niemals so fröhlich empfinden könne wie heute«, sagt Hattenhauer.
Auf der Leipziger Montagsdemonstration im Sep- tember '89 dann die letzte Aktion: Mit einem Trans- parent mit der Aufchrift »Für ein offenes Land mit freien Menschen« wagen sich Hattenhauer und ihre Gefährtin Gesine Oltmanns aus der vor Eingriffen
Die Vergangenheit will sie jedoch nicht vergessen. Im Gegenteil, ein Werk aus der Zeit vor ihrer Inhaf- tierung ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen: ein zusammengesunkener Clown, farblos und resi- gniert. »Damit will ich die Entwicklung zeigen, die ich in den letzten 15 Jahren durchgemacht habe«. Der Clown ist auch auf einem ihrer neuen Bilder zu sehen - als bunter Harlekin, der in beschwingter Leichtigkeit über den Dächern der Stadt tanzt. Die Ausstellung »Freiheit wagen« ist bis Mai in der Kanz- lei Streitbörger/Speckmann am Adenauerplatz 4 zu sehen.
HELDEN DER FRIEDLICHEN REVOLUTION
Die Freiheit wagen
Widerstand mit Risiko - Am 9. Oktober 1989, dem Tag der Entscheidung, sitzt Katrin Hattenhauer im Gefängnis
Von THOMAS MAYER
2009 wird die Friedliche Revolution 20 Jahre alt. In einer Porträtserie werden bekannte, unbekannte, aber auch schon vergessene Geschichten von Menschen publiziert, die in vorderster Reihe mit dafür sorgten, die SED-Diktatur zu beseitigen.
Katrin Hattenhauer, vor 40 Jahren in Nordhausen geboren, lebt im Piemont (Italien) oder in Berlin- Charlottenburg. Gerade kehrte sie mal wieder von einem mehrmonatigen Aufenthalt aus dem Land ihrer Träume zurück. Sie ist seit Jahren freischaf- fend als bildende Künstlerin tätig, malt expressiv und mittlerweile sehr farbig, gestaltet exotische Körperbilder mit Materialien, verbindet Strick, Pap- pe und Sperrholz mit ihrer Malkunst — und kennt die Unsicherheit so eines Gelderwerbs: »Ich kann mir natürlich vorstellen, welch' gutes Gefühl es sein muss, jeden Monat einen sicheren Obolus aufs Kon- to zu bekommen. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich alle möglichen Berufe ergreifen müssen, die mir aber nicht so wichtig sind wie der des Künstlers. »Das ist der Preis, den ich gewillt bin zu zahlen«. Und staunt über sich, »so eine unsichere Nummer, so ein Lufteimer« geworden zu sein.
Schon als Kind malte Katrin gern und viel und war im Teenager- alter »Ausmaler« der Kulissen am Theater ihrer Heimatstadt. Sie engagierte sich in
Im Knast war der Entschluss gereift, sich nie mehr in irgendwelche Abhängigkeiten zu begeben. Draußen erfuhr sie vom stattgefundenen Leipziger Wunder und inszenierte als Erstes im Abrisswohn- haus in der Meißner Straße nach dem Vorbild von Hermann Hesses »Steppenwolf«-Dichtung ein »Magisches Theater«. Von oben bis unten wurde das Treppenhaus mit Bildern dekoriert, von denen schon mal eins für zehn Negerküsse einen Besitzer fand. »Es war eine befreiende Aktion, mit der mir klar wurde, es freischaffend als Künstlerin zu versu- chen und nicht mehr in den Schoß der Kirche zurück zu kehren. Ich konnte nicht vergessen, dass sich mein Arbeitgeber in einer für mich sehr komplizier- ten Zeit von mir trennen wollte«, erinnert sie sich an dramatische Zeiten.
Sie malt Bilder, freut sich über steigende Anerken- nung wie jüngst dank einer Ausstellung in Bologna und würde im kommenden Revolutions-Gedenkjahr gern in Leipzig ausstellen. Es wäre eine Heimkehr zur rechten Zeit. »Freiheit wagen« ist ein Katalog betitelt, der anlässlich eines Kunstprojektes an der internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte im polnischen Kreisau, wo sich einst Widerstand gegen das Hitler-Regime formierte, erschien. »Kreisau steht für ein Zeugnis von Mut — Mut, den Menschen in schweren Zeiten aufgebracht haben«, sagte Freya von Moltke.
Katrin Hattenhauer nimmt sich das Recht heraus, ein Leben zu leben, das sie nicht nach dem puren Nutzen ausrichten will. Die Grenzfälle, die sie erleb- te, sind schuld daran.
Eine der mutigsten Revolutionäre saß am 9. Okto- ber 1989 im Knast und bekam nicht mit, was sich an diesem Tag auf Leipzigs Straßen ereignete. Sie hörte merkwürdige Schallwellen, das Gefängnis erzitterte, doch die drin saßen mussten annehmen, draußen rollen die Panzer. Die Einzelhaft schlauch- te. Mehrfach wurde sie in der Nacht zur Verneh- mung gebracht. Es gab keine körperliche Gewalt, seelische jedoch zur Genüge. Die Stasi spielte mit all ihren Tricks der Einschüchterungen und Demüti- gungen, um den Stolz zu brechen. Was nicht ge- lang. Die letzten zwei Wochen versuchte Katrin Hattenhauer sogar, nicht zu den Vernehmungen zu gehen und sagte stattdessen zum Schließer: »Seit wann kommt denn der Knochen zum Hund ...« Erst am Freitag, dem 13. Oktober 1989, war sie wieder frei. Ihr Vernehmer sagte bei der letzten Begeg-
Katrin Hattenhauer, damals 20 Jahre jung, räumte — auch weil sie selbst Schaden vom Theologi- schen Seminar abwenden wollte — das Feld und stieg vehement in die Arbeit der Gruppe Gerech- tigkeit der Leipziger Opposition ein. In ihr verein- ten sich Leute, die nichts mehr zu verlieren hatten, die Ende der 1980er Jahre ganz am Rand der DDR-Gesellschaft angekommen waren, die alles auf eine Karte setzen konnten. Man war Revoluzzer, wollte diesen »Beruf« so gut wie möglich machen und scheute nicht das Risiko.
Am Messemontag des 4. September 1989 forderte Katrin Hattenhauer die Staatsmacht gezielt heraus. Mit Gesine Oltmanns trug sie das Plakat mit